Die Eskalation des Schreckens
Die in Deutschland immer wieder kaskadenartig geführte Kriegsschulddebatte, in deren Zentrum seit Anfang der 1960er Jahre die Thesen des Hamburger Historikers Fritz Fischer stehen, hat den politischen Blick auf den Ersten Weltkrieg und seine Folgen eher verstellt als geöffnet.





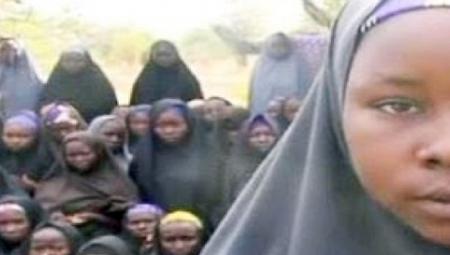








![Biblioteca General Antonio Machado: "[Iustitia]"|https://www.flickr.com/photos/fdctsevilla/3680735931/
__BREAK__(Attribution License)|https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/](/sites/default/files/styles/teaser_home_standard/public/images/ausgaben/2014/03/justicia.gif?itok=U4I4r0nY)







