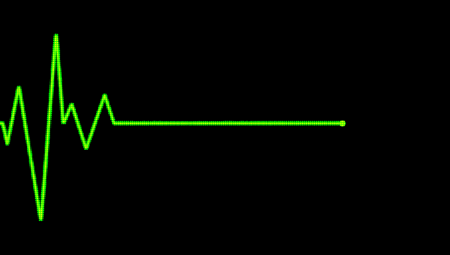Europa tickt deutsch
Eine derartige Präsenz hat die Bundeskanzlerin in den bald zehn Jahren ihrer Regentschaft noch nicht erlebt: erst ihr engagierter Versuch der Beilegung der Ukrainekrise, dann der Poker mit der neugewählten Regierung von Alexis Tsipras um einen Schuldennachlass und den Verbleib Griechenlands in der Eurozone.