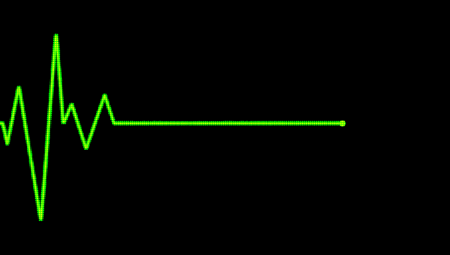Eine andere Welt ist möglich!
Darüber, dass der Weltwirtschaft ziemlich unerfreuliche Zeiten bevorstehen, herrscht fast allgemein Übereinstimmung. Selbst wenn sie nicht einer weiteren, verheerenden Krise entgegentreibt, dürfte sie in einer Art Stagnation münden.