Hartz IV: Im Dschungel der Kompetenzen
„Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.“ Diese Antwort erhalten Bundestagsabgeordnete häufiger, wenn sie nachfragen, wie es denn so läuft mit der Umsetzung von Hartz IV in den Jobcentern. Und wer zu viel fragt, der wird bei Frage 2 auch mal „auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen“. Und die lautet?





















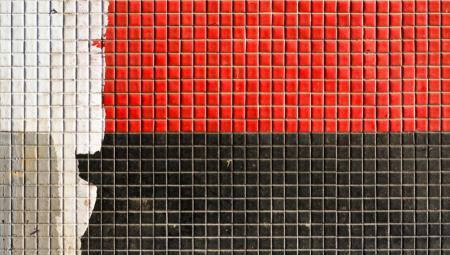

![Dimitris Graffin: "Riga Palamidou st., Psyrri - Ρήγα Παλαμήδου, Ψυρρή [destroyed]"|https://flickr.com/photos/127226743@N02/21575637570
__BREAK__(Attribution License)|https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/](/sites/default/files/styles/teaser_home_standard/public/images/ausgaben/2018/07/kissmerk.jpg?itok=TOUcUyxf)



