Vereinigte Pleitestaaten von Amerika
Mit einem Trick hat Scott Walker, der mit Hilfe der Tea Party frisch gewählte republikanische Governeur von Wisconsin, es geschafft: Um den maroden Haushalt des Bundesstaates zu sanieren, lehnte der Gouverneur Steuererhöhungen rundweg ab und verlegte sich auf Ausgabenkürzungen.



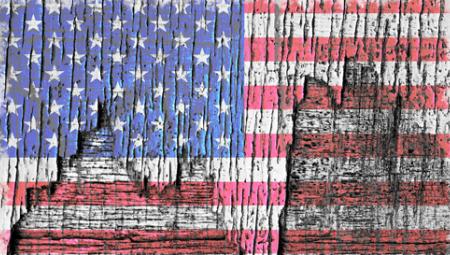







![Mr Wabu: "No Parking [squared circle]"|https://www.flickr.com/photos/oxborrow/1547341778/
__BREAK__(Attribution-ShareAlike License)|https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/](/sites/default/files/styles/teaser_home_standard/public/images/ausgaben/2010/10/schlepptau.jpg?itok=11sH96P9)






