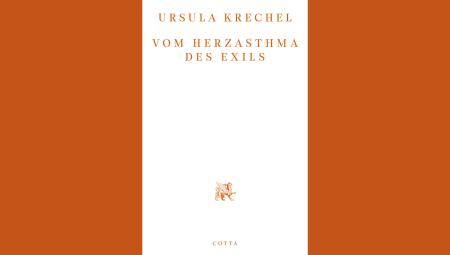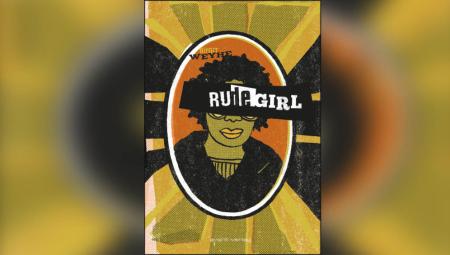Syrische Geflüchtete: Win-win statt one-way
Neulich in der Sauna: 40 überwiegend Weiße Frauen und Männer warten dicht gedrängt auf Said, den Mann mit den Birkenzweigen, der zu russischer Musik den Aufguss versprüht. Said ist Syrer. Bis in die Sauna haben es die Syrer:innen also geschafft, und überall in den deutschen Alltag: Sie sind Lieferanten, IT-Experten und Erzieherinnen, Frisöre, Busfahrer und Bauelektriker.