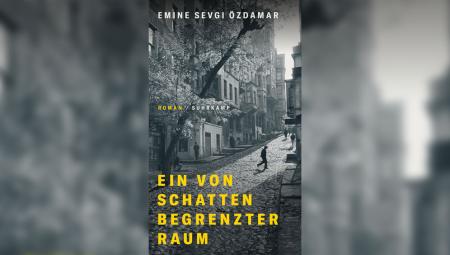Europas Abschied vom Asylrecht: Das Drama an Polens Grenze
An den europäischen Außengrenzen werden Schutzsuchende immer öfter brutal abgewiesen. Die Eskalation der Situation an der polnisch-belarussischen Grenze markiert eine besonders dramatische Episode dieser systematischen Politik der Entrechtung.