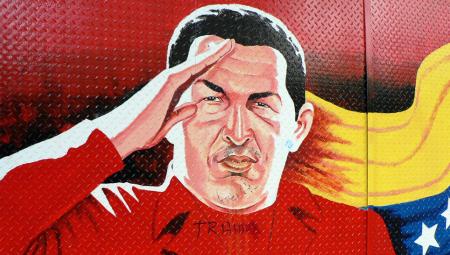Die Vergötzung des Marktes
Am 15. September treten wir in das zehnte Jahr der globalen Finanzkrise ein, die sich, ausgehend von dem Crash der US-amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers im September 2008, regelrecht schockartig über die ganze Erde verbreitet hat.