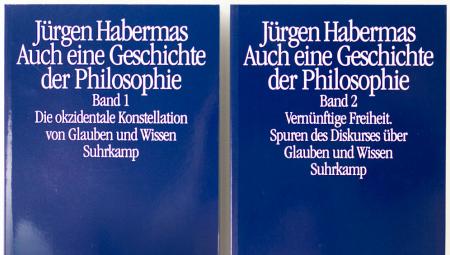Corona-Impfstoff: Speed schlägt Sicherheit
Der Wettbewerb um die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs ist in vollem Gange. Doch dabei geht es um mehr als gesundheitssichernde Vorsorge. Speed-Forschung nennt sich diese auf Turbo justierte Wissenschaft, bei der Zeit auf Kosten der Sicherheit geht.