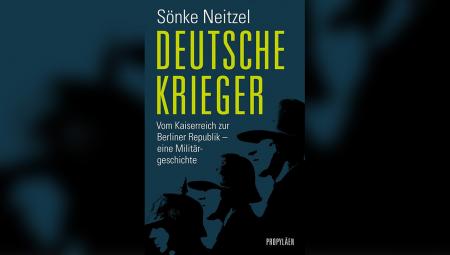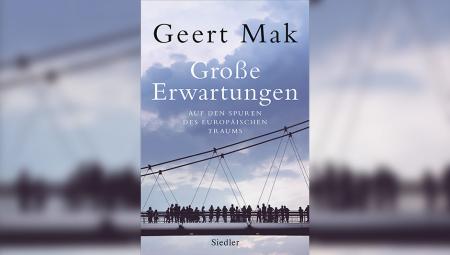Westsahara: Trumps letztes Opfer?
Ein fast vergessener Brandherd in einer scheinbar verlassenen Weltregion hat sich wieder entzündet: der Westsahara-Konflikt. Anfang Dezember flackerten die Kämpfe zwischen der marokkanischen Armee und der für die Unabhängigkeit der Sahrawi kämpfenden Frente Polisario wieder auf. Fast 30 Jahre hatte der unter Vermittlung der Vereinten Nationen 1991 geschlossene Waffenstillstand zwischen beiden Parteien gehalten; der nun aus dem Amt geschiedene US-Präsident Donald Trump hat ihn auf den letzten Metern seiner Amtszeit aufs Spiel gesetzt.