»Kitschig, larmoyant und voller Klischees«
Den Begriff „Frauenliteratur“ mag eigentlich niemand. Aber benutzt wird er ständig, wenn über Bücher geredet wird – im Buchhandel, in den Medien und im Privaten. Er scheint also irgendwie notwendig oder wichtig zu sein.



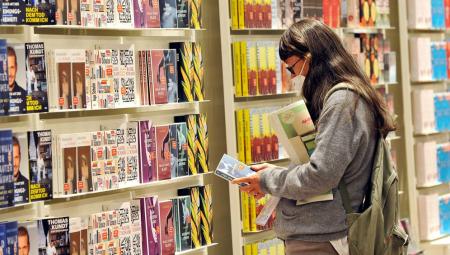









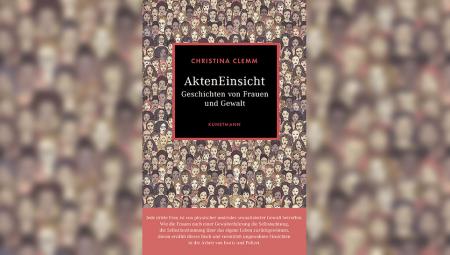


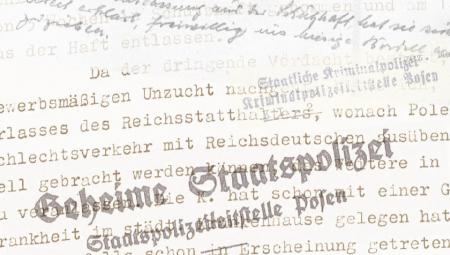





![DVIDSHUB: "Afghan women voice concerns to coalition forces [Image 4 of 4]"|https://flickr.com/photos/dvids/5577207534__BREAK__(Attribution License)|https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Afghanistans vergessene Frauen](/sites/default/files/styles/teaser_home_standard/public/images/ausgaben/2019/03/afghirl.jpg?itok=bigdlxRX)




