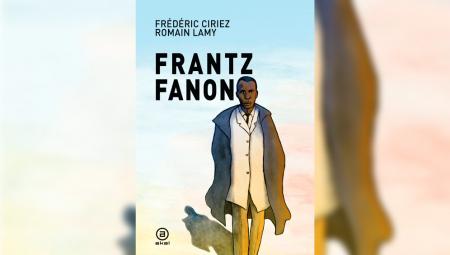Europa und Afrika: Beginn einer wunderbaren Partnerschaft?
Nach fünf Jahren kam man endlich wieder zusammen. Die EU und ihr afrikanischer Widerpart, die Afrikanische Union, tagten Mitte Februar zum sechsten Mal miteinander in Brüssel. Visionen und Perspektiven prägten die Zusammenkunft ebenso wie aufgestauter Frust.