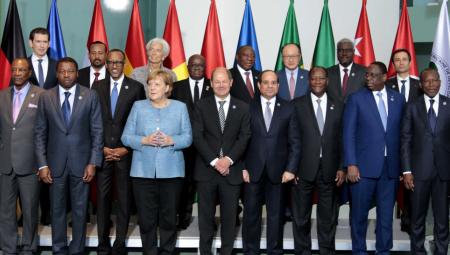USA und China: Kooperation statt Kalter Krieg
In Washington ensteht zunehmend ein Konsens, demzufolge die Beziehungen zwischen den USA und China ein ökonomisches und militärisches Nullsummenspiel sind. Setzt sich diese Ansicht durch, wird die dringend benötigte internationale Kooperation immer schwieriger zu erreichen sein.